Was der Schreiber so liest (22)
Frederick Forsyth: Das vierte Protokoll (1984)
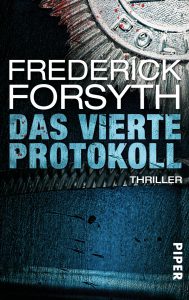
Es waren nur wenige Klassiker der Unterhaltungsliteratur, die ich aus dem dazugehörigen Regal meines Vaters in meine kleine Bibliothek rettete. Mario Puzos „Der vierte K.“ gehörte ebenso dazu wie Frederick Forsyths „Das vierte Protokoll“ – die auffällige Zahl war dabei wirklich Zufall. Von Forsyth kannte ich bereits jüngere Titel, wie „Der Rächer“ oder „Der Afghane“.
Auch das „Protokoll“ erwies sich als spannender Agenten-Thriller, wenngleich er erwartungsgemäß alle Klischees des Genres bedient. Vom Leser wird ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit verlangt; nicht nur, um bei der Vielzahl der britischen Sicherheitsbehörden den Durchblick zu behalten, sondern vor allem, weil Forsyth ein dichtes Netz miteinander verwobener Handlungsstränge bei einer großen Personage knüpft.
Im Kern geht es um einen geplanten Anschlag mit einer kleinen Atomwaffe, die das titelgebende vierte Protokoll unterläuft, eine Abmachung der Atommächte, sich nicht mit kleinen schmutzigen Waffen anzugreifen. Forsyth lässt den Leser dabei sein, wenn die ebenso finsteren wie hochintelligenten Moskauer Bösewichte den Plan ersinnen. Noch stärker beleuchtet er freilich die britische Seite, bei der er sich bestens auszukennen scheint – war der 1938 geborene Autor nach eigenen Angaben doch jahrelang selbst Agent des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6. Er macht keinen Hehl daraus, wer die Guten und wer die Bösen zu sein haben; angesichts des Erscheinungsjahres des Buches darf das niemanden wundern.
Es ist eine atemlose Jagd auf den Attentäter, ein Wettlauf mit der Zeit, der den Leser gut bei Laune hält, und es ihm erleichtert, sich weitestgehend ermüdungsfrei durch den immerhin 500 Seiten dicken Wälzer zu lesen. Ein paar Schnörkel und Schleifen in der Handlung hätte Forsyth weglassen können, gleichermaßen ein paar allzu detailliert geschilderte Lebensläufe von Nebenfiguren – der Mann wollte uns halt beweisen, dass bei ihm keine Allerweltsfiguren auftauchen dürfen.
Sehr raffiniert das (ebenfalls lässliche) Doppelspiel um einen österreichischen Agenten, dessen es ebenfalls gar nicht bedurft hätte, um die Geschichte funktionieren zu lassen. Doch das gab Forsyth die gute Gelegenheit, das Bild von den grundsätzlich fehlerfrei arbeitenden Spionen der Super-Geheimdienste, zu denen er neben seinem eigenen ritterlich auch den KGB zählt, zu zementieren.
Und noch einen kleinen Trick wendet er an. Er lässt einen seiner Protagonisten darüber grübeln, warum Journalisten und Autoren immer die Geheimdienstler als Träumer ansehen. Nein – diese seien die Realisten und die Politiker die Träumer. „Wenn die Träume das Kommando übernehmen, endet die Sache mit der Schweinebucht“, lässt er den Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 sinnieren. Damit stellt sich Forsyth – wie immer vor Selbstbewusstsein platzend – über alle anderen Autoren des Genres.
Dennoch scheint mir „Das vierte Protokoll“ aktueller denn je. Der Tod des mit Polonium vergifteten Ex-KGB-Agenten Alexander Litwinenko 2006; der 2012 beim Joggen in London zusammengebrochene Whistleblower Alexander Perepelitschny, in dessen Magen man starkes Pflanzengift gefunden hatte; der „Selbstmord“ des ehemaligen russischen Oligarchen Boris Beresowski, der 2013 in London erhängt aufgefunden wurde; und in diesem Jahr die Vergiftung des ehemaligen russischen Geheimdienstoffiziers Sergej Skripal und seiner Tochter beweisen hinlänglich: Der schmutzige Krieg der Geheimdienste hält unvermindert an. Wer dabei die Bösen und die Guten sind, lässt sich in der Realität eben nicht so einfach beantworten wie es uns Frederick Forsyth suggeriert. Und auch die Details, mit denen er schildert, wie Einzelteile einer verheerenden Waffe vor den Augen der Sicherheitsorgane in ein Land geschmuggelt werden können, tragen in unseren Tagen nicht zur Beruhigung der Leser bei. Aber wenigstens zum Nachdenken – was bei einem so alten „Agenten-Schinken“ eben nicht selbstverständlich ist.
